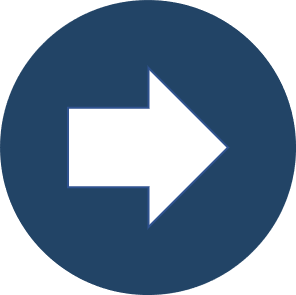93v
93v
 93r
93r
Pax tibi a patre Christi/ amen. Cum te diligo/ haud queo
tibi animum meum celare/
eciam si iuxta voluntatem ista non
respondero. Neque tu mihi succensere debes/ aut
quicquam mali
suspicari/ aut animum tibi hunc esse alienatum. Quandoquidema
possit tui esse amantissimus, qui
te nedum carpit, sed vul-
nerat. Quoniam meliora sunt vulnera diligentis
quam frau-
dulenta inimici oscula.3Sic itaque ad tuas litteras4/ mihib
alioqui longe charissimas/ respondeo. Suaderi
vix possum alio signo5 Christi oves felicius colligi quam
veritatisc sibilo. Iuxta Esaiam et Zachariam.6
Equidem blasphemiis in Christum deum, ne
demones
quidem congregarem. Caeterum dolos scripturarum pro
regulis non cito.
Ut autem cesses hostiam sustollere7/
et hortor et
obsecro, quia blasphemia est in Christum
crucifixum. At cantelenis sanctis populum
incen-
dere minime puto vel iniquum vel ab institutis divinis
abhorrere.8Verum cum subtexis/ quod ad Schnebergenses
et 15 pagos etc. hortationisd aliquid scribam.9 neutiquam
valeo comprobare, id quod tu probas. Videntur enim mihi eiusmodi
foedera cum dei
voluntate vehementer pugnare. animosque
timoris spiritu10 aspersos incredibili nocumento afficere.
Et pro
fiducia benedictionis in deum vivum, fiduciam male-
dictionis/ ad
hominem11 i'd est' ad
baculum harundineum inserere.12
quod, quam sit impium, nosti. et quam a deo trepidas alienet
mentes/ easque reddat ad audiendum domini vocem ineptas/
incapacesque/ passim
scripturis declaratur/ quibus
eciam tacentibus experiencia in plateis clamabit
grande
atque spissum esse preputium cordis13 fiduciam et animum in homines
iacere. preterea cum foret
nobis moriendum oculos
haberemus in vulgi opinionem et auram emissos, quo haud
scio an sit ullus gladius acutior/ ad disperdendum nos.
optarem tibi tueque societati ut temperavisetis vobis
ab
illiusmodi et litteris et conventiculis,14 quae hic nostratibus
pepererunt metum tolerandorum malorum,
quae minus
ut latrones aut sediciosi fuimus tolleraturie.
15 Ego istam
procaciam quam demiror quam abhorreo Atque palam fatebor
nihil
 93v
mihi vobiscum in tali conatu confederationeque
commune futurum.16
Consulo
93v
mihi vobiscum in tali conatu confederationeque
commune futurum.16
Consulo
idem quod Christus consuluit/ quod denique nullus prophetarum
non
consulit: Ut tu una cum fratribus nostris charissimis spem
in unum Deum
ponatis,17 qui potens est
vestros adversarios con-
fundere〈.〉 Porro si
contemplatione iudiciorum dei fueris petitus
scis me tibi, teque mihi vicissim
debere animam.18Lubenter
tibi veritatem dei annuncianti adero opera,
approbatione eciam
morte. Ubi videro Philisteum aliquem prodire et castris
dei
obblatterare〈.〉19Addis ut uxorem meam20 salutem, feci. Ipsa te
tuamque21
diligenter
resalutat, optatque ut incolumes agatis. Rogo ut
boni consulas responsum hoc tibi
enim faveo ac cedo. Cur
filiolum meum
Abraamum malis quam andream vocari discere
ex te velim
rationem〈.〉22 Vale in Christo Jesu feliciter. saluta
atque
conforta fratres nostros in Christo23 Datum Orlamunde die
Julii 19
anno MDXXIIII.
Tuus Andreas
Carolostadius.
Beilage: Sendbrief der Orlamünder an die Allstedter, [Orlamünde], 1524, [um 19. Juli]
 A1r Der von Orlemund
A1r Der von Orlemund
schrifft an
die zu Alstedt/ wie man Chri-
stlich fechten soll.
Wittemberg.
M.D.XXIIII.
 A1v
A1v
Der von Orlemund schrifft
an
die zu Alstedt: wie man
Christlich fechten
soll.
Gotlichen frid durch
Christum unsern Herrn. Lieben
Bruͤder/ die schrifft so
yhr an
uns verfuͤgt24/ haben
wyr nach
muͤglichem verstandt verlesen25/
unnd ursach euers
schreibens
vernommen/ wilchs ist/ stoͤcken
und ploͤcken26 der Christen umb
euch hyn und
widder.27 Hierauff euer
bitt/ was
wyr hierbey thun wollen/ euch das selbig widder-
umb
schrifftlich zukommen lassen etc.28Wissen wyr
euch bruderlicher treu nicht zu
bergen/ Das wir dar-
bey mit weltlicher were29 (haben wyr anders euer
schrifften recht
verstanden30) gar nicht zu
thun kun-
nen. So ist es uns zuthun nicht befolhen/ die weyl
Christus Petro seyn schwert eyn zu
stecken gepotten
hat/ und ym nicht stadten31 vor yhn zu kempffen/ dann32
die zeyt und stund seines leydens war nahe.33Also wenn
die zeyt und stund vorhanden kompt34/ das wir etwas
von wegen Gottlicher gerechtigkeyt leyden
sollen/
So last uns nicht zu messern und speissen35 lauffen/
und den ewigen willen des vaters aus
eygener ge-
walt zu verjagen/ So wyr doch teglich bitten. Deyn
will
geschehe36/ Wolt yhr aber
widder euer feynd ge-
wappent37 seyn/ so kleydt euch mit dem starcken ste-
heln38 und unuͤberwindlichen
harnisch des glaubens/
 A2r
davon S. Paulus Ephesios .6.
schreibt39/ so werdet
A2r
davon S. Paulus Ephesios .6.
schreibt39/ so werdet
yhr
euere feynd redlich uberwinden und zu schan-
den machen/ das sie euch
auch nicht eyn eynigs40 har
verletzen werden.41 Das
yhr aber schreybt/ wyr sollen
uns zu euch gesellen und mit euch verpinden oder
ver-
knupffen/ Darauff yhr dann die schrifft .4. Reg. 24.42
wie sich Josias mit Gott und dem volck verpunden
habe/
eyngefuͤrt.43 Wyr finden am ort/
das Jo-
sias als yhm das gesetzbuch zu kame/ eyn verpunt-
nis mit Gott gemacht hat/ das er nach dem herren
wandelen wolt/ seyn gesetz/
gepott/ cerimonien ym
hertzen aus gantzen krefften bewaren/ und die wort
des
bunds ym selbigen buch beschrieben erwecken/
und das volck hat disem verpuntnis
gehoͤrcht44/ Das
ist/ der Konig und das volck haben sich zugleich mit
Gott verpunden. Denn so45 sich
Josias mit Gott/ und
auch dem volck
verpunden hette/ were seyn hertz zu
spalten gewest/ Gott und den Menschen willen
wol-
gefallen/ So doch Christus spricht/ Nyemant kan
zweien
herren dienen.46 Darumb lieben
bruder/ so
wyr uns mit euch verpuntten/ weren wyr nicht me-
hr
freye Christen/ sondern an menschen gepunden/
Das wurde denn erst dem
Evangelio eyn recht Ce-
tergeschrey47 bringen. Da sollten die
Tyrannen froͤlo-
cken/ und sprechen. Dise rhuͤmen sich des
eynigen48
Gottis/ Nu
verbint sich eyner mit dem andern/ yhr
Gott ist nicht starck genug sie zu
verfechten.49 Item
sie
wollen eygen Secten50/ emporunge
und auffrur
machen. Last sie wurgen und umbringen/ ehe sie
uber uns
mechtiger erwachssen. So musten wyr
denn der ursach halben/ und nicht von wegen
der
gestrengen gerechtigkeyt Gottis sterben/ Was wolt A2v Gott hyrzu sagen? were solchs Gottlicher warheit
A2v Gott hyrzu sagen? were solchs Gottlicher warheit
nit eyne grosse unehr
und abbruch? Nicht also lieben
bruder/ Vertrauet aber alleyn auff Gott/ wie
der
konig Abia thet Paralip'omena'. 13.
da er von seynen feynd-
ten umbringet war51/ wie auch die kinder von Isra-
hel/
do52 sie von dem Pharao bis
auffs rott mer ver-
folget wurden/ und doch wunderlich ym verttrau-
en zu Gott erlost und erhalten sind.53Darumb hoͤret
und vernempt
alleyne die waren red Gottis/ eyn
ytzlicher54 nach seynem pfand55/ und acht nicht/ ob sich
der Tyrannisch gewalt gegen
euch widderspenstig
sich erhebt56/ Denn das sind die Apostel und alle hey-
ligen Gottis/ auch
Christus selbst nicht vorhaben57
gewest/ Sonst euer lere
gezeugknis58 zu geben/ so
ferne
sie von Gott ist/ wollen wyr gern das gezeugnis des
heyligen geysts/
und durch die milten gaben Gottis
mitgeteilt mit nicht sparen/ und ob59 rechenschafft
des glaubens von
uns gefoddert wurde/ froͤlich er-
fur treten/ das selbig zu
verantworten60/
unangesehen/
ob sich alle Tyrannische wuͤtterey wider uns erhube/
und uns
biss ynn todt verfolget. Aber alles durch
hulff und stercke Gottis. Der
wegen lieben bruder/
lernt alleyn thun den ewigen willen Gottis un-
sers hymlischen vaters/ den er uns durch seynen
eyngeboren son Christum ym
heyligen geyst
offenbar gemacht hat/ So wird yhr euer
hertzen von allen
anfechtunge ynn
Gott zu friden stellen/ Das
helff uns Gott allen
AMEN
Die gemeyn Christi zu Orlamuͤnde61
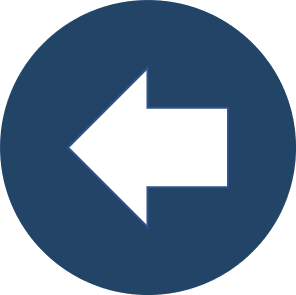 KGK 261
KGK 261 Einleitung
Einleitung